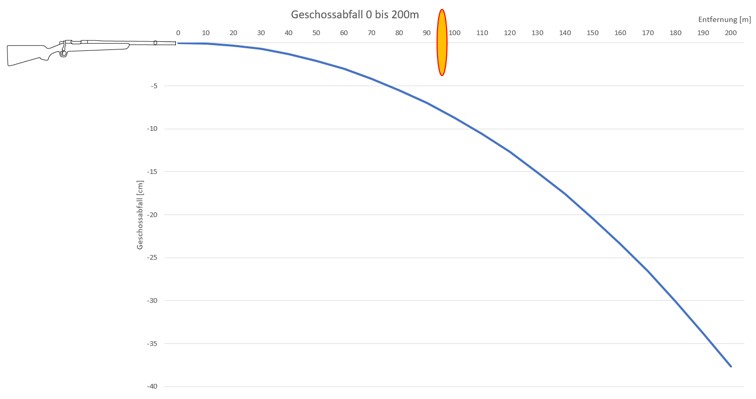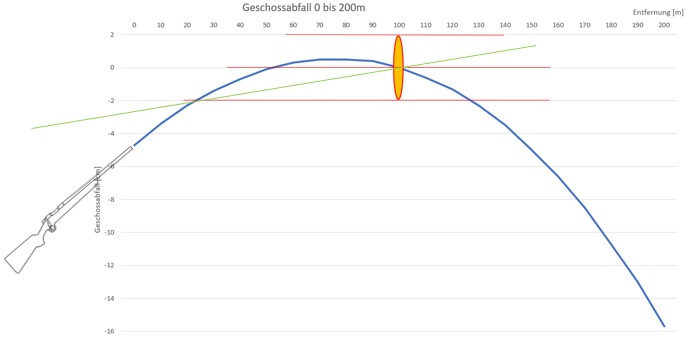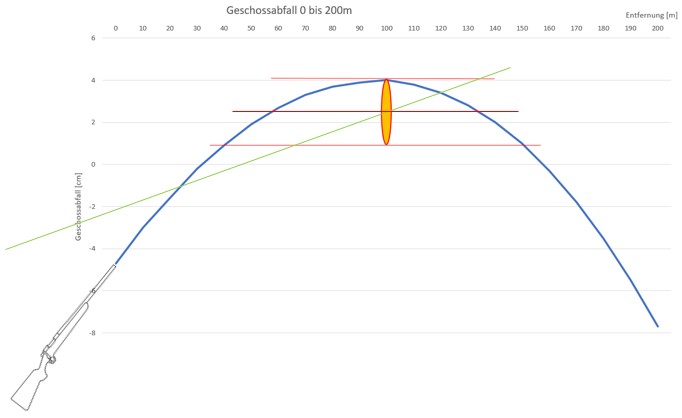Am vergangenen Freitag wurde auf der Website der „European Wilderness Society“ ein interessanter Artikel veröffentlicht der meiner Meinung nach Erwähnung verdient. Der Artikel „Wolfpacks Manage Disease Outbreaks“ also „Wolfsrudel steuern Krankheitsausbrüche“ geht dabei auf Daten aus der Slowakei ein, die belegen sollen dass der Wolf die Ausbreitung der klassischen Schweinepest eindämmen oder sogar stoppen kann.
Hier zunächst eine kurze Zusammenfassung und Übersetzung des Artikels:
Wölfe sind als faule Jäger bekannt. Daher wählen sie immer die einfachste Beute aus, d.h. junge, kranke oder alte Tiere. Diese Präferenz für die leichte Beute beeinflusst die Populationsdynamik und Altersstruktur des Wildes. Insbesondere beim Ausbruch von Krankheiten spielt der Wolf eine entscheidende Rolle, um die Anzahl der befallenen Tiere in Schach zu halten. Daten aus der Slowakei unterstreichen die wichtige Position des Wolfes als „Arzt der Wildnis“.
Der Artikel geht davon aus, dass die natürliche Auslese die ASP in Schach halten kann. Fakt ist, dass die ASP durch Körperflüssigkeiten der erkrankten Tiere weiter getragen wird und dass der Mensch mit kontaminierten Fahrzeugen, Kleidung sowie mit Jagd- und landwirtschaftlichen Geräten Hauptüberträger ist.
Wildschweine gehören zu den Haupt-Nahrungsquellen der Wölfe und ein geschwächtes Tier ist einfacher und risikoloser zu erlegen als ein gesundes und wehrhaftes Tier. Anhand von Grafiken werden Studien zur klassischen Schweinepest aus den 1990er und 2000er Jahren dargestellt aus denen hervorgeht, dass es in Wolfsgebieten 13 Mal weniger befallene Wildschweine gab (7% in Wolfsgebieten und 93% in den übrigen Gebieten).
Soweit zum Artikel.
Zwei Fragen müssen wir (Jäger) uns stellen:
- Sind die Erkenntnisse aus der Slowakei auf die ASP übertragbar?
- Hat der Wolf wirklich nur negative Presse verdient?
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nennt auf seiner Internetseite eine Inkubationszeit von 2 bis 15 (typischerweise 4) Tagen für die ASP. Danach bricht die Krankheit aus und verläuft in 7 bis 10 Tagen fast immer tödlich. Die Symptome sind zunächst hohes Fieber und Abgeschlagenheit gefolgt von Husten, Atemnot, blutigem Durchfall, Erbrechen etc. Die Inkubationszeit und der Verlauf sind bei der ASP also eher etwas kürzer als bei der klassischen Schweinepest. Müde und abgeschlagen, also eine leichte Beute, sind die Tiere aber in beiden Fällen. Da nur Schweine infiziert werden können und diese sich frühzeitig absondern könnte es also durchaus sein, dass die selektive Jagd des Wolfes sich positiv auf die Ausbreitung der ASP auswirkt.
Man darf auf jeden Fall gespannt sein und ich hoffe, dass es objektive, wissenschaftliche Studien zu diesem Thema geben wird, wenn die ASP erst einmal großflächig ausgebrochen ist.
Bis dahin sollten wir (Jäger) uns vielleicht etwas zurückhalten und Propaganda und Polemik in unseren Diskussionen nicht die Oberhand gewinnen lassen. Damit disqualifiziert man sich schnell. Nicht alles was man hört ist zwangsläufig immer wahr und sollte, ohne es zu hinterfragen, weitergetragen werden. Auch dann nicht, wenn es genau das ist was man gerne hören möchte.
Die Ausbreitung der ASP von Schwein zu Schwein hat nur bei zu hoher Wilddichte eine Chance. Eine zu hohe Wilddichte ist immer schädlich. Das gilt auch für den Wolf. Der reguliert seine Wilddichte allerdings selbst erheblich besser als wir die Wilddichte bei den Wildschweinen.
Für die ruhigen Tage der Weihnachtszeit noch etwas zum Nachdenken: Angenommen der Wolf wird als jagdbares Wild in das BJagdG aufgenommen. Wird das dann so formuliert, dass wir Jäger auch für den Wildschaden aufkommen müssen, den der Wolf verursacht?